Ohne Partner oder Partnerin kommt man beim Seilklettern nicht weit. Wir sind auf die Person am anderen Ende des Seils angewiesen. Im besten Fall ist diese Seilpartnerschaft keine reine Zweckbeziehung, sondern eine, in der man voneinander lernt, sich Feedback gibt und gegenseitig unterstützt. Dafür muss man sich aufeinander einlassen und seinen Teil dazu beitragen, dass es funktioniert.
Doch beim Klettern sind wir oft Stresssituationen ausgesetzt, in denen wir uns nicht von unserer besten Seite zeigen. Für die Sportpsychologin Madeleine Crane, Gründerin von Climbing Psychology, ist alles eine Frage der Kommunikation.
Anhand von vier konkreten Beispielen wollen wir uns in diesem Artikel anschauen, was in der Seilpartnerschaft schief laufen kann und vor allem: wie es besser geht.
Stressmanagement beim Klettern

Frida klettert eine Route an ihrem Limit. Leonie sichert. An einer schwierigen Stelle kommt Frida nicht weiter, wird zunehmend unsicherer und frustriert. Plötzlich blafft sie Leonie an, alles mache sie beim Sichern falsch: zu viel Seil, zu wenig Seil, zu hart, zu weich, zu wenig Hilfestellung, zu viel Hilfestellung. Irgendwann ist es Leonie zu viel und sie blafft zurück. Frida schnauzt, Leonie solle sie ablassen. Die Stimmung ist im Eimer.
Es passiert besonders Anfängern, die ihre mentale Belastbarkeit noch nicht kennen: Eine Route fühlt sich unerwartet schwer an, man kommt nicht weiter. In einer solchen Situation kommt Frust auf und es ist besonders leicht, den an der Partnerin auszulassen. Madeleine Crane erklärt, warum das so ist: "Auch wenn sie sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist, deuten Fridas widersprüchliche Aussagen und ihre Gereiztheit auf eine Angstreaktion hin." Angst kann ganz unterschiedliche Ursachen haben: "Angst vor dem Unbekannten, vor Orientierungs- oder Kontrollverlust, oder ganz konkret Sturzangst. Es können aber auch soziale Ängste eine Rolle spielen. Man ist beim Seilklettern ja nie allein, es gibt immer eine Person, die einem zuschaut. In diesem Kontext können auch Versagensängste aufkommen, also davor, von einer anderen Person verurteilt zu werden."
Dass uns die Angst vor dem Unbekannten, davor die Kontrolle zu verlieren oder uns zu blamieren, in dem Moment gar nicht bewusst ist, bedeutet nicht, dass sie sich nicht bemerkbar macht. Die Psychologin erklärt: "Eine Angstreaktion kann sich auf motorischer Ebene zeigen: Manche fangen an zu zittern, die Nähmaschine zu bekommen, die Bewegungen werden abgehackt. Andere fallen in eine Schockstarre, halten den Atem an. Oder es zeigt sich auf somatischer Ebene: Einige haben das Gefühl, vor dem Klettern ständig auf die Toilette zu müssen, andere können nicht essen, ihnen wird übel, sie fangen an zu schwitzen. Manche werden laut, laufen hochrot an, oder werden eben wütend und blaffen jemand anders an. Das alles sind Mechanismen, um mit überfordernden Situation umzugehen."
Angst zu haben, ist normal. Beim Klettern sind wir oft Situationen ausgesetzt, die uns an unsere Grenzen treiben. Daher ist es besonders wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu wissen, was uns triggert. Sonst kann unbewusste Angst schon einmal dazu führen, dass wir überreagieren und – wie in diesem Fall – die Partnerin anblaffen. Damit schützen wir uns davor, uns selbst die Blöße zu geben. Doch im schlimmsten Fall sind am Ende beide frustriert.
Madeleine rät: "Wer sich im Voraus, in einem stressfreien Rahmen mit der eigenen Angst auseinander setzt, kann sie auch in der Wand frühzeitig wahrnehmen und entsprechend reagieren. Dafür ist es wichtig, sich zu fragen: Was ist mir eigentlich wichtig? Was brauche ich in der Wand, damit ich mich wohlfühle? Wie sollte mein Sicherungspartner sich verhalten, damit ich alles geben kann? Was hilft mir, mich in stressigen Situationen verletzlich zu zeigen?" Wenn wir uns mit uns selbst auseinander setzen und auch unsere Partnerin weiß, wann sie pushen und wann eher beruhigen soll, ist die Wahrscheinlichkeit, in unangenehme Situationen zu geraten, viel geringer.
Rollenaufteilung in Lehrer & Schüler
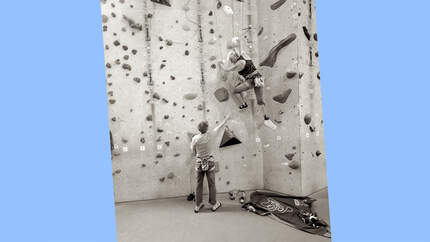
Otto klettert schon lange, Sara hat gerade erst angefangen. Sie gehen regelmäßig zusammen zum Fels. Dann steigt Otto vor und hängt ein Toprope in die Route. Wenn Sara einsteigt, will Otto es ihr leichter machen: "Rechter Fuß weit raus, nein! Noch weiter nach rechts! Hüfte eindrehen, und Klipp! Nein, nein, mit der anderen Hand." Otto freut sich, wenn Sara es genauso macht, wie er es ansagt. Auch Sara wird unsicher, wenn sie eine Stelle nicht lösen kann. Bei der kleinsten Unsicherheit ruft sie nach unten: "Wie hast du das hier noch einmal gemacht? Ah, ja, rechter Hook, und dann hoch an den Seitgriff… Stimmt!"
Madeleine rät, genauer hinzusehen: "Zunächst würde ich fragen: Was wünscht sich die Person, die klettert? Wenn Sara so klettern möchte, ist es natürlich völlig legitim, Tipps entgegenzunehmen." Doch für viele Kletterbegeisterte besteht der Reiz gerade im Herumprobieren, Tüfteln, Rätsellösen: "Nicht nur, dass wir alle unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben und die richtige Beta für die eine Person nicht unbedingt die beste für die andere sein muss. In dem Moment, in dem die kletternde Person eigentlich ausprobieren und lernen möchte, nimmt das kontinuierliche Tippgeben und Ansagen der anderen Person die Möglichkeit, selbst Erfahrungen zu sammeln."
Eigene Erfahrungen zu sammeln, ist dabei gerade für Anfänger wichtig. Denn so lernen sie, wozu ihr Körper in der Lage ist, bauen Selbstbewusstsein auf und lernen, Situationen realistisch einzuschätzen. Madeleine betont: "Je mehr Erfahrung wir in herausfordernden Situationen sammeln, desto besser lernen wir, wie wir damit umgehen, anstatt die Verantwortung von vornherein abzugeben."
Wie also umgehen mit einer eingespielten Dynamik wie im Fall von Otto und Sara? "Die Dynamik sollte erst einmal geprüft werden," schlägt Madeleine vor: "Wollen wir es wirklich beide so, oder haben wir uns einfach so an die Situation gewöhnt, dass es ganz normal geworden ist?" Ganz allgemein rät sie: "Sichernde Personen – aber auch Boulderer in der Halle – sollten sich angewöhnen zu fragen: Möchtest du einen Tipp von mir haben? Man kann auch festlegen, dass die kletternde Person nachfragt, wenn sie gerne einen Tipp hätte." Natürlich fühlt es sich gut an, jemandem zu helfen. Aber selbst ein gut gemeinter Tipp ist im Zweifelsfall nicht die beste Hilfestellung. Denn wahrscheinlich lernt die andere Person mehr, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen machen kann.
Der soziale Vergleich

Simon und Zora trainieren zusammen und klettern auch häufig gemeinsam am Fels. Seit einiger Zeit haben sie dasselbe Projekt und beide haben große Fortschritte darin gemacht. Simon ist sich sicher, dass heute der große Tag ist – der Durchstieg ist in greifbarer Nähe. Zora ist da unsicherer – doch plötzlich passiert es: Sie findet den perfekten Flow, schwebt durch die Crux und findet sich auf einmal am Umlenker wieder. Auf einmal kann Simon sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, in seinem Kopf gibt es nur einen Gedanken: Wenn Zora die Tour geschafft hat, dann muss es bei mir doch auch klappen, schließlich war ich viel näher dran!
Madeleine erklärt: Wir können uns gut vorstellen, dass es für Simon und Zora anfangs sehr motivierend war, ein gemeinsames Projekt zu haben und sich gegenseitig zu pushen. Doch plötzlich steigt Zora die Route unerwartet als Erste durch. Die Psychologin erläutert, was in diesem Moment passiert: "Während des gemeinsamen Projektierens war der Fokus der beiden prozessorientiert: Es ging um den Austausch und das gemeinsame Lösungsfinden. Auf einmal ist Druck da – das verschiebt den Fokus, er wird ergebnisorientiert." Während wir uns beim Projektieren über kleine Fortschritte freuen, zählt auf einmal nur noch der Durchstieg. Das verändert unsere Herangehensweise ganz grundlegend. Doch es findet noch eine weitere Veränderung statt, so Madeleine: "Simon und Zora befinden sich auf einmal in einem Konkurrenzkampf, in einem sozialen Vergleich." Wenn wir uns mit jemandem vergleichen, der oder die stärker ist als wir, spricht man von upward social comparison: "Dieser Vergleich kann uns motivieren und anspornen oder aber unserem Selbstvertrauen einen Dämpfer geben und Selbstzweifel und Unmut wachsen lassen."
In beiden Fällen konzentrieren wir uns nicht mehr auf das, was in unserer Kontrolle liegt. Madeleine erklärt: "Es gibt so viele kleine Dinge, die stimmen müssen, damit der Durchstieg gelingt: Wir müssen alles geben, alles riskieren, gut visualisieren, unsere Kräfte gut einteilen, richtig schütteln und und und… Selbst wenn wir einen noch so guten Versuch machen, kann es immer sein, dass der Fuß rutscht." Zwischen dem Anfang und dem Ende der Route liegen viele kleine Schritte. Wenn wir die Konzentration nur auf das Top richten, führt das ironischerweise dazu, dass es unwahrscheinlicher wird, es zu erreichen. Der Grund dafür: "Wenn wir uns nicht mehr auf kontrollierbare Variablen konzentrieren, sondern auf externe, unkontrollierbare Variablen, verlieren wir den Fokus auf das Hier und Jetzt." Ähnlich ist es beim Vergleichen: "Wer nur darüber nachdenkt, was die andere Person geschafft hat, ist nicht bei sich selbst, nicht präsent, sondern im Außen. Auch was die anderen machen, ist eine unkontrollierbare Variable."
Anstatt auf externe Faktoren sollten wir uns also auf die kleinen Prozessziele, die "kontrollierbaren Variablen", konzentrieren. Doch wie ist das möglich? Es ist leichter gesagt als getan, gesteht auch Madeleine: "Erst einmal sollten wir uns bewusst machen, welches die kontrollierbaren Variablen sind: Welche kleinen Prozessziele könnte ich mir setzen? Auf welche kleinen Schritte muss ich achten, um die Wahrscheinlichkeit, zum Top zu kommen, zu vergrößern?" Auch mit Enttäuschung umzugehen, ist nicht immer leicht: "In dem Moment, in dem in unserem Beispiel Zora die Route klettert, braucht es sehr viel Akzeptanz. Es kann schwierig sein, sich davon abzugrenzen. Hilfreich ist es, sich in dem Moment zu sagen: Jetzt bin ich dran! Ich gebe heute mein Bestes, egal was dabei rauskommt!"
Wir sollten also versuchen, die Erwartung loszulassen, die wie ein schweres Gewicht an uns hängen kann. Wenn wir uns für den Erfolg der anderen Person aktiv freuen und ihr gönnen, verändern wir den Fokus vom Mangel hin zum Positiven. "Eventuell kann es auch helfen, eine räumliche Distanz zu schaffen, kurz auf die Toilette zu gehen, um alleine zu sein und bei sich selbst anzukommen. Auch eine Atemübung kann es leichter machen, wieder im Hier und Jetzt anzukommen," schlägt Madeleine vor. Während des Kletterns kann ein innerer Monolog hilfreich sein, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Wenn wir im Hier und Jetzt sind, uns auf jeden einzelnen Zug konzentrieren und unser Bestes geben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das Ziel zu erreichen.
"Spring doch einfach!"
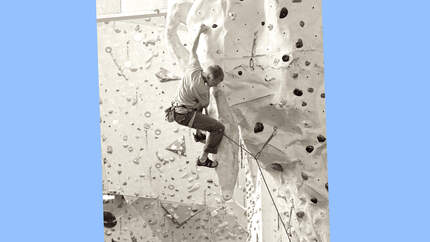
David sieht sich als Boulderer. Am Seil fühlt er sich nicht so richtig wohl, das Klippen irritiert ihn und sobald er über der Exe steht, bekommt er Panik. Konrad liebt es, am Seil zu klettern und hat David überzeugt, mit ihm und ein paar Freunden einen Trip in sein Lieblingsklettergebiet zu machen. David hat sich breitschlagen lassen. Nun hängt er auf 20 Metern Höhe am Fels, die Griffe in seiner Hand sind gut, doch der letzte Haken ist einen Meter unter ihm und der nächste genauso weit entfernt. Seine Knie beginnen zu zittern, er weiß weder vor noch zurück. "Spring einfach!" ruft Konrad ihm von unten zu. "Du wirst schon sehen, dass es gar nicht so schlimm ist! Na los! Trau dich!" David wird schummrig vor Augen, zwischen den Rufen von Konrad, seinen zittrigen Beinen und dem Haken unter sich kann er keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also lässt er los. Er fällt weich – doch es war das letzte Mal, dass er mit Konrad auf einen Klettertrip gegangen, geschweige denn vorgestiegen ist.
Offensichtlich ist David von der Situation überfordert. "Wenn ich wenig Erfahrung mit etwas habe, dann ist es ganz natürlich, dass es mir Angst macht," bestätigt Madeleine Crane. Das gilt für jemanden, der lange nicht mehr vorgestiegen ist. Aber genauso würde es einem Seilkletterer gehen, der noch nie draußen bouldern war und auf einmal die unebenen Crashpads unter sich sieht – ungewohnte Situationen lösen Angst aus.
Die Psychologin veranschaulicht dies: "Jeder Mensch hat eine Komfortzone, eine Stresszone und schließlich eine Panikzone – wo die Grenzen liegen ist individuell ganz unterschiedlich. Der Fehler, den wir im Umgang mit Sturzangst oft machen, ist dass wir uns entweder gar nicht aus der Komfortzone bewegen – also zum Beispiel immer nur im Nachstieg klettern – oder, dass wir uns zu viel zumuten – uns also direkt in die Panikzone begeben." Dabei gilt es eigentlich, den guten Mittelweg zu finden: "Wenn ich mich weiter entwickeln und besser werden will, muss ich mich aus meiner Komfortzone hinaus und in die Stresszone bewegen. Wir lernen weder, wenn wir in der Komfortzone bleiben, noch, wenn wir uns in unsere Panikzone begeben." Neuropsychologische Untersuchungen zeigen: Mental herausgefordert zu werden, bringt uns weiter. Aber Überforderung hat genau den gegenteiligen Effekt. Darum müssen wir uns dem, was uns Panik macht, langsam und schrittweise annähern.
Für David liegt der Sprung ins Seil in der Panikzone. Konrads Ermutigungen haben daher einen gegenteiligen Effekt: Sie sorgen für Druck und Erwartungen. Daher appelliert Madeleine: "Die Verantwortung, wann es okay ist zu springen und wann nicht, muss jede Person selbst übernehmen. Denn niemand anders kann wissen, was für mich in Ordnung ist, weil die Person nicht in meinem Kopf ist, nicht meine Erfahrungswerte hat. Nur weil es für jemand anders okay ist zu stürzen, heißt das nicht, dass die subjektive – also die von mir wahrgenommene – Gefahr nicht viel größer ist."
Dennoch hört man in Hallen, bei Trainings und Kursen oder am Fels immer wieder die Aufforderung: "Spring einfach!" Doch ein solches Sturzerlebnis kann traumatisierend sein. Madeleine schlägt vor: "Stattdessen sollte Konrad David unterstützen. Statt ‚Spring einfach!‘ sollte er verständnisvoll mit der Angst umgehen: ‚Hey, ich bin da! Ich sichere dich weich!‘ Oder er sollte es ihm ermöglichen, erst einmal kleinere Stürze zu machen oder in einfachere Routen zu gehen." So kann David sich langsam in unbekanntes Terrain wagen. Denn: "Gerade am Anfang geht es ja vor allem darum, wieder ins Seilklettern reinzukommen: Wie ist es, im Seil zu hängen und aus 20 Metern Höhe hinabzuschauen? Das kann schon genug der Herausforderung sein, ohne gleich am physischen Limit zu klettern oder riesige Stürze hinzulegen."
Indem wir uns schrittweise annähern, lernen wir auch, Situationen und Gefahren besser einzuschätzen: "Vielleicht fällt es mir im Überhang leichter zu stürzen? Dann kann man erst einmal direkt bei der Exe springen und wenn das okay war, das nächste Mal zehn Zentimeter drüber. Dadurch wächst auch das Selbstvertrauen." Und auf einmal wird das, was davor Stresszone war, zur Komfortzone. Und das, was Panikzone war, wird zur Stresszone: "Je mehr wir üben, desto mehr wächst unsere Komfortzone."
Mehr:









